Klassische und provinzialrömische Archäologie
Womit befasst sich der Fachbereich klassische und provinzialrömische Archäologie?
Dem Fachbereich klassische und provinzialrömische Archäologie obliegt die wissenschaftliche Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Archäologie mit den Schwerpunkten klassische und provinzialrömische Archäologie unter Einschluss der prähistorischen und mittelalterlichen Archäologie des Ostalpenraumes. Gegenstand ist das materielle Erbe der antiken Kulturen des Mittelmeerraumes, d. h. der griechischen und der römischen Kultur sowie von deren Randkulturen. Die zeitlichen Grenzen lassen sich mit der minoischen und mykenischen Kultur Griechenlands einerseits und der spätantiken und frühchristlichen Kultur andererseits umreißen.
Innerhalb der Schwerpunktsetzung des Fachbereichs finden sich weitere universitätsinterne Forschungsprojekte einzelner Mitarbeiter:innen. Zu den Schwerpunkten zählen
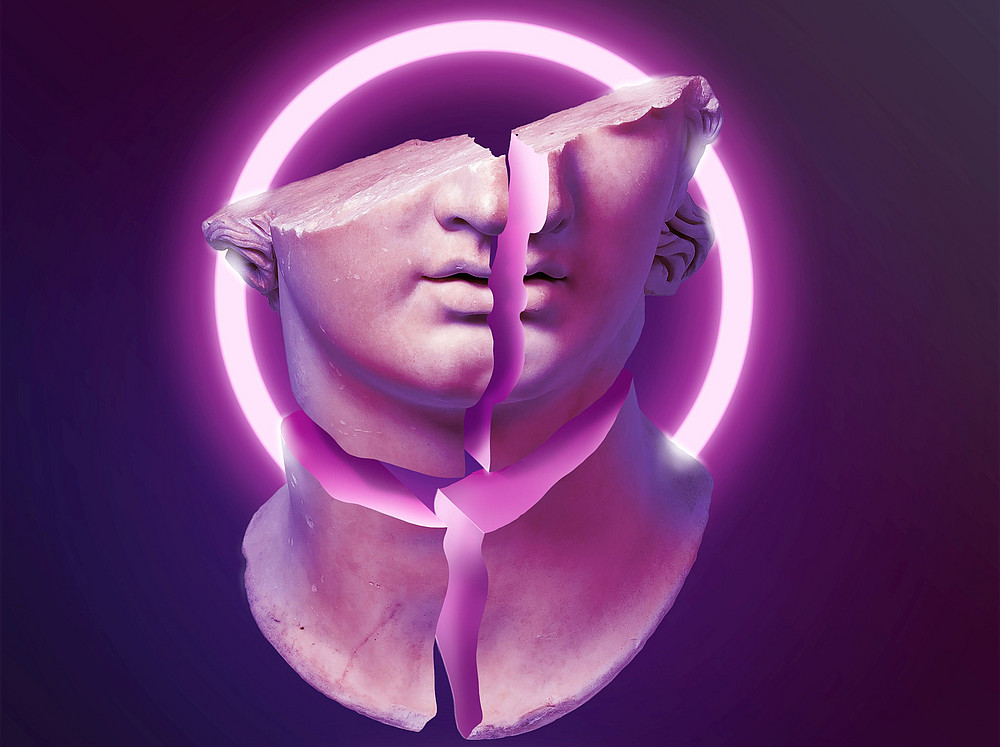
Laufende Forschungsprojekte
Laufende Survey- und Grabungsprojekte
Fördergeber

